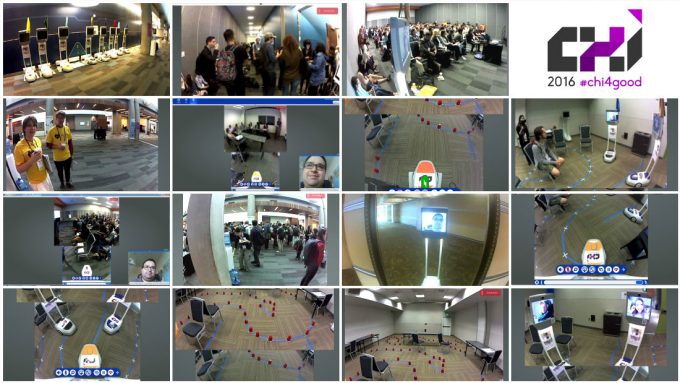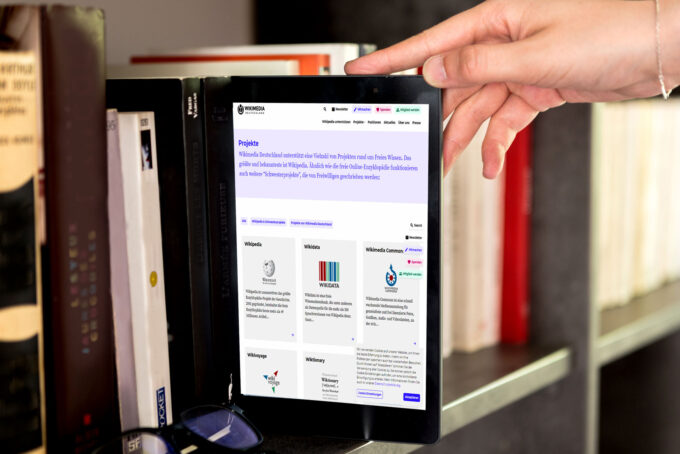Einblicke in Interoperabilität und Linked Data im Bereich Kulturerbe und Forschung: Brücken bauen zwischen den Disziplinen
Interoperabilität mag technisch klingen, aber im Kern geht es um Verbindung – darum, Daten, Systeme und Menschen dabei zu unterstützen, effektiver zusammenzuarbeiten. Sowohl im Bereich des Kulturerbes als auch in der Forschung ist sie es, die aus verstreuten Sammlungen gemeinsames Wissen macht. Maryam Mazaheri erläutert häufige Missverständnisse rund um Interoperabilität und beschreibt, welche Erkenntnisse daraus gewonnen werden können.
von Maryam Mazaheri (Universitätsbibliothek Maastricht)

In der Welt von Open Science ist Interoperabilität der unsichtbare Klebstoff, der Zusammenarbeit ermöglicht. Maryam Mazaheri, Produktverantwortliche für Linked Data an der Universitätsbibliothek Maastricht, beschreibt, was wichtig ist, um Interoperabilität zu gewährleisten.
Warum Interoperabilität wichtig ist
Interoperabilität stellt sicher, dass Daten aus verschiedenen Systemen reibungslos ausgetauscht, verstanden und wiederverwendet werden können. Die FAIR-Prinzipien beschreiben Interoperabilität als eine der vier Grundlagen einer guten Datenpraxis, neben Findability (Auffindbarkeit), Accessability (Zugänglichkeit) und Reuse (Wiederverwendbarkeit). Das „I“ für Interoperability (Interoperabilität) in FAIR wird jedoch oft missverstanden: Es geht nicht nur um die Verwendung eines gemeinsamen Formats, sondern um eine gemeinsame Bedeutung, Struktur und Governance.
Die vier Ebenen der Interoperabilität – technische, syntaktische, semantische und organisatorische – veranschaulichen diese Entwicklung. Die technische und syntaktische Ebene stellen sicher, dass Systeme miteinander verbunden werden können und das Daten konsistenten Strukturen folgen. Die semantische Interoperabilität fügt durch Vokabulare und Ontologien Bedeutung hinzu, während die organisatorische Interoperabilität Vorgehensweisen und Arbeitsabläufe aufeinander abstimmt. Wenn alle vier Ebenen zusammenkommen, können Daten reibungslos zwischen Projekten, Institutionen und sogar Disziplinen ausgetauscht werden.
Linked Data als gemeinsame Sprache
Hier kommt Linked Data ins Spiel. Durch die Verknüpfung von Datensätzen über gemeinsame Identifikatoren und strukturierte Metadaten ermöglicht Linked Data es Maschinen (und Menschen), Beziehungen zwischen Entitäten – einer Person, einem Ort oder einer Veröffentlichung – über Fachgebiete hinweg zu verstehen. Im Bereich des kulturellen Erbes hat dies die Art und Weise verändert, wie kulturelle Einrichtungen ihre Sammlungen online sichtbar machen (zum Beispiel die digitalen Sammlungen der Universitätsbibliothek Maastricht). Initiativen von Organisationen wie Europeana, dem niederländischen digitalen Erbe-Netzwerk Dutch Digital Heritage Network (Netwerk Digitaal Erfgoed) und Universitätsbibliotheken, darunter die Universitätsbibliothek Maastricht, veranschaulichen, wie Linked Data kulturellen Einrichtungen dabei hilft, digitalisierte Objekte, Metadaten und Normdateien miteinander zu verknüpfen, um die Auffindbarkeit zu verbessern. Dies erleichtert nicht nur den Zugang, sondern ordnet Objekte auch in einen breiteren kulturellen und historischen Kontext ein. Im Forschungsbereich unterstützt Linked Data die Interoperabilität zwischen Repositorien, Datenmanagementsystemen und wissenschaftlichen Wissensgraphen, sodass Forschende sinnvolle Verbindungen zwischen Datensätzen, Publikationen und Personen herstellen können.
Gemeinsame Herausforderungen und praktische Erkenntnisse
Trotz Fortschritten ist Interoperabilität selten unkompliziert. Einige Missverständnisse bestehen weiterhin:
- Die Verwendung desselben Dateiformats (wie CSV oder JSON) garantiert keine Interoperabilität, wenn Metadaten und Semantik unterschiedlich sind.
- Es ist nahezu unmöglich, Interoperabilität am Ende eines Projekts „hinzuzufügen“ – sie muss von Anfang an mitgedacht werden.
- Standards allein lösen das Problem nicht; Zusammenarbeit und Abstimmung tun dies.
Diese Erkenntnisse spiegeln sich in Initiativen wie dem Dutch Interoperability Network wider, das Expert:innen aus Universitäten, Organisationen und Kulturerbe-Einrichtungen in den Niederlanden zusammenbringt, um Praktiken auszutauschen und ein domänenübergreifendes Verständnis aufzubauen. Ihre Diskussionen zeigen, wie kontextabhängig Interoperabilität ist – sie hängt davon ab, wer die Daten verwendet, zu welchem Zweck und in welcher Umgebung. Was für einen biomedizinischen Datensatz funktioniert, passt möglicherweise nicht zu einem historischen Archiv, doch beide können von gemeinsamen Rahmenwerken und gegenseitigem Lernen profitieren.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, muss der Fokus von isolierten Projekten auf eine gemeinsame, community-getriebene Entwicklung verlagert werden. Interoperabilität wird gefördert, wenn Bibliotheken, Forschende und Datenverwalter:innen zusammenarbeiten, um ihre Standards, Tools und Governance aufeinander abzustimmen. Die Stärkung dieser Verbindungen schafft die Grundlage für eine breitere europäische und internationale Koordination.
Ausblick
In ganz Europa treiben Initiativen wie die EOSC Technical and Semantic Interoperability Task Force sowie Standards und Richtlinien wie GO FAIR und das Cross-Domain Interoperability Framework (CDIF) die Bemühungen voran, die technischen, semantischen und rechtlichen Aspekte des Datenaustauschs aufeinander abzustimmen. Anstelle von festen Rahmenwerken fungieren diese Initiativen als Kooperationsnetzwerke und Sammelstellen bewährter Verfahren, die gemeinsame Standards und Richtlinien fördern. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Datenintegration nicht nur innerhalb einzelner Disziplinen, sondern auch disziplinübergreifend zu ermöglichen.
Kulturerbe und Lebenswissenschaften werden oft als führende Beispiele genannt – erstere aufgrund ihrer reichhaltigen, mehrsprachigen Metadaten und ihrer Kultur des offenen Austauschs, letztere aufgrund ihrer frühzeitigen Einführung von Ontologien und maschinenlesbaren Daten. Beide zeigen, dass Interoperabilität dort gedeiht, wo Gemeinschaften über institutionelle Grenzen hinweg zusammenarbeiten.
Letztendlich geht es bei Interoperabilität weniger um Technologie als um ein gemeinsames Verständnis. Es handelt sich um eine langfristige Verpflichtung zur Entwicklung von Systemen – und Beziehungen –, die es ermöglichen, dass Daten frei fließen, aussagekräftig bleiben und mit jeder Verbindung an Wert gewinnen.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Interoperability as a key factor for digitalisation — a success story for cross-sector knowledge transfer
- Interoperability: unifying and maximising data reuse within digital education ecosystems (OECD report)
- Ambitionierte Vorreiterin für Open Science: Das sind die TOP-Prioritäten bei der EOSC Association
- Data Stewards: Zentrale Anlaufstelle für Forschungsdaten und Open Data
- Projekt FAIR Data Spaces: Verteiltes Datensystem für Industrie und Forschung
- Barcamp Open Science 2025: Von Bedrohungen zu kollektiver Resilienz
Maryam Mazaheri ist Produktverantwortliche für Linked Data an der Universitätsbibliothek Maastricht. Sie koordiniert Projekte zu Linked Open Data und Interoperabilität im Bereich Kulturerbe und Forschung. Maryam ist auf LinkedIn und auf Orcid zu finden.
Porträt, Foto Credit: Maastricht University Library©
View Comments

Open-Access-Tage 2025: Ziel erreicht – oder wie kann es (jemals) gelingen?
von Dr. Juliane Finger, Ronja Kuhlwilm, Olaf Siegert, Helene Strauß Die diesjährigen...